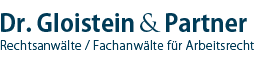Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
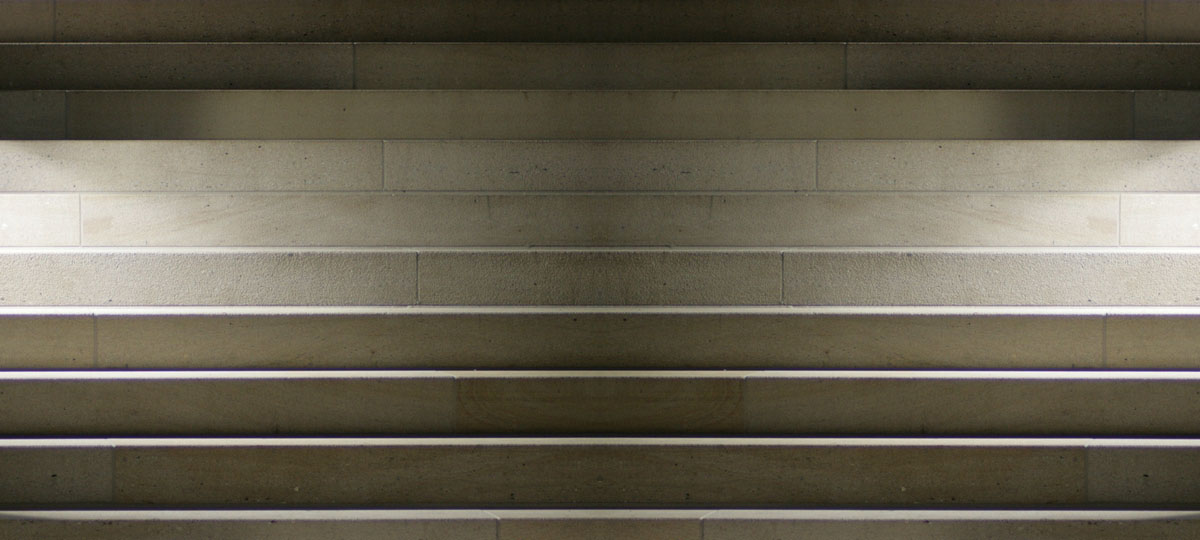
Lohnfortzahlung bei Erkrankung des Kindes – Das gilt es zu beachten:
Grundsätzlich besteht ein Anspruch auf Vergütung nur dann, wenn der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung zur Arbeitsleistung auch tatsächlich nachgekommen ist. Von diesem Grundsatz kennt das Gesetz jedoch zahlreiche Ausnahmen. So bleibt der Vergütungsanspruch z.B. gemäß § 2 Abs. 1 EFZG auch an Feiertagen und gemäß § 3 Abs. 1 EFZG bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit über einen Zeitraum von sechs Wochen bestehen.
Doch auch in Fällen, in denen die Arbeitsleistung nicht erbracht werden kann, weil das Kind des Arbeitnehmers erkrankt ist, kann der Anspruch auf Arbeitsentgelt erhalten bleiben:
Regelungen und Voraussetzungen des Anspruchs aus § 616 BGB
Hier folgt ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltfortzahlung aus § 616 BGB. Diese Norm berechtigt einen Arbeitnehmer, der kurzfristig, unverschuldet und aus in seiner Person liegenden Gründen an der Arbeitsleistung gehindert ist, zum Fernbleiben von der Arbeit und regelt zugleich den Erhalt des Vergütungsanspruchs.
Die Erkrankung des Kindes stellt einen solchen Fall der Arbeitsverhinderung durch einen in der Person des Arbeitnehmers liegenden Grund dar. Im Regelfall begründet § 616 BGB daher sowohl einen Freistellungsanspruch, als auch einen Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung.
616 BGB setzt aber ferner voraus, dass die Verhinderung nur für einen unerheblichen Zeitraum bestand. Die Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs „nicht erhebliche Zeit“ wird durch die Rechtsprechung nach dem Verhältnis von Dauer des Arbeitsverhältnisses zur Dauer der Verhinderungszeit vorgenommen (vgl. BAG, Beschluss vom 17.12.1959 – GS 2/59).
Im Falle der Pflege eines erkrankten Kindes wird man sich an § 45 SGB V orientieren können. Je Pflegefall wird ein Zeitraum bis zu fünf Tagen als verhältnismäßig nicht erheblich anzusehen sein (vgl. BAG, Urteil vom 07.06.1978 – 5 AZR 466/77). Dauert die Verhinderung jedoch länger an, so entfällt der Vergütungsanspruch nicht lediglich in der übersteigenden Höhe, sondern in Gänze (vgl. BAG, Urteil vom 20.07.1977 – 5 AZR 325/76).
Gestaltungsmöglichkeiten
Zu beachten gilt es jedoch, dass ein solcher Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 616 BGB abbedungen werden kann.
Der Ausschluss der Rechtsfolgen des § 616 BGB kann durch eine entsprechende Regelung im Arbeitsvertrag erfolgen. Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung kann hierdurch in Gänze ausgeschlossen, oder auch nur eingeschränkt werden. Sinnvoll kann auch eine zeitliche Konkretisierung der Freistellungsdauer bei den einzelnen Verhinderungsfällen sein.
Zu beachten ist aber, dass der Freistellungsanspruch (unentgeltlich) durch tarif- oder arbeitsvertragliche Regelung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Im Falle der Erkrankung des Kindes ist der Arbeitnehmer bereits wegen Unmöglichkeit im Sinne des § 275 Abs. 3 BGB an der Arbeitsleistung gehindert (vgl. LAG Hamm, Urteil vom 27.08.2007 – 6 Sa 751/07).
Verhältnis zum Anspruch auf Krankengeld gegen die Krankenkasse
Des Weiteren stellt sich in diesem Zusammenhang immer wieder die Frage, ob der Arbeitnehmer nicht einen Anspruch auf sog. „Kinderpflegekrankengeld“ gegen seine Krankenversicherung hat.
Gemäß § 45 SGB V haben gesetzlich Versicherte einen Anspruch auf Krankengeld, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann und das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Zu beachten ist, dass dieser Anspruch jedoch nur besteht, wenn das Kind gesetzlich krankenversichert ist (vgl. BSG, Urteil vom 31.03.1998 – B 1 KR 9/96R).
Ist das erkrankte Kind z.B. bei dem privat versicherten Elternteil mitversichert, besteht kein Anspruch auf „Kinderpflegekrankengeld“ nach § 45 SGB V.
Darüber hinaus handelt es sich bei dem Anspruch gegen die Krankenkasse ohnehin lediglich um einen subsidiären, d.h. nachrangigen Anspruch. Vorrangig besteht der Anspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber. Mithin ist eine Leistungspflicht des Arbeitgebers nicht dadurch ausgeschlossen, dass bereits eine Krankenkasse Krankengeld gezahlt hat. Vielmehr kann die vorleistende Krankenkasse die Zahlung des Entgelts vom Arbeitgeber aus übergegangenem Recht (§ 115 SGB X) an sich verlangen (vgl. LAG Berlin, Urteil vom 07.07.1975 – 5 Sa 35/75).
Fazit
Soweit die Regelung des § 616 BGB nicht arbeits- oder tarifvertraglich ausgeschlossen ist, haben Arbeitnehmer einen Anspruch auf Fortzahlung ihrer Vergütung, wenn sie zur Pflege ihres erkrankten Kindes für eine nicht erhebliche Zeit der Arbeit fernbleiben. In solchen Fällen besteht ein Anspruch auf „Kinderpflegekrankengeld“ gegen die Krankenkasse nur, wenn das erkrankte Kind gesetzlich krankenversichert ist. Darüber hinaus ist dieser Anspruch nur subsidiär; primär ist der Arbeitgeber zur Fortzahlung der Vergütung berufen.
In den vielgestaltigen Fragestellungen beraten und unterstützen wir Sie gern.
Kategorien und Themen
- Allgemein (5)
- Arbeitsrecht (164)
- Betriebsverfassungsrecht (38)
- Insolvenzrecht (1)
- Gebühren / Kosten (2)
- Gesellschaftsrecht (4)
- Sozialrecht (1)
- Rentenrecht (1)
- Zivilrecht (2)