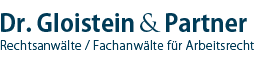Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
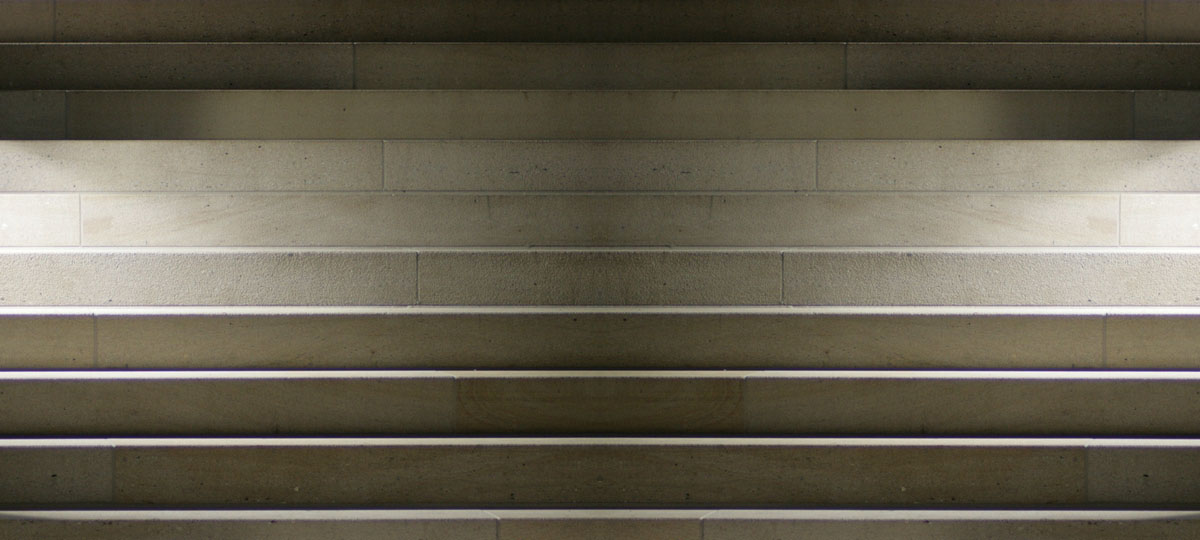
Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit – Inhalt und Grenzen der Entgeltfortzahlung im Arbeitsverhältnis
Das Arbeitsverhältnis ist ein Austauschverhältnis. Der Arbeitnehmer erbringt die Arbeitsleistung gegen Zahlung der vereinbarten Vergütung (Lohn). Bei Wegfall der Leistung entfällt regelmäßig die Gegenleistung; es gilt der Grundsatz „ohne Arbeit kein Lohn“ (§§ 275 Abs. 1, 26 BGB).
Dieser Grundsatz wird im Arbeitsverhältnis vielfach durchbrochen. In gesetzlich besonders geregelten Fällen behält der Arbeitnehmer einen Vergütungsanspruch trotz nicht erbrachter Arbeitsleistung. Eine solche Regelung enthält § 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz. Danach hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, wenn er durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert ist, ohne dass ihn ein Verschulden trifft. Das Gesetz sieht hier aber nur einen vorübergehenden Anspruch von 6 Wochen vor.
1. Voraussetzungen der Entgeltfortzahlung
Wesentliche Voraussetzung für die Annahme eines Entgeltfortzahlungsanspruchs ist die auf einer Krankheit beruhende Arbeitsunfähigkeit.
Der Begriff der Krankheit ist im Entgeltfortzahlungsgesetz nicht näher definiert. Er wird in Literatur und Rechtsprechung mit einem regelwidrigen Körper- und Geisteszustand umschrieben, der einer Heilbehandlung bedarf (BAG, Urteil vom 07.12.2005, Az.: 5 AZR 228/05).
Die Krankheit muss zur Arbeitsunfähigkeit führen. Hierbei ist es erforderlich, die konkreten Anforderungen an den Arbeitsplatz zu betrachten und diese dem Gesundheitszustand des Arbeitnehmers gegenüber zu stellen. Nicht jede Krankheit führt zur Arbeitsunfähigkeit. Kann die jeweilige Arbeit auch mit der vorliegenden Erkrankung angetreten und erbracht werden und besteht nicht das Risiko der Infektion anderer Mitarbeiter, besteht für den jeweiligen Arbeitsplatz Arbeitsfähigkeit. Allerdings ist zu beachten, dass die gesundheitliche Eignung zur Erbringung von Teiltätigkeiten am Arbeitsplatz nicht ausreicht, um Arbeitsfähigkeit zu bejahen. Eine „Teil-Arbeitsunfähigkeit“ kennt das Gesetz nicht. Der Arbeitnehmer ist auch nicht verpflichtet eine Teilleistung, die ihm gesundheitlich gerade noch möglich ist, zu erbringen. Andererseits bleibt es dem Arbeitgeber unbenommen, bei angezeigter Krankheit des Arbeitnehmers zu prüfen, ob unter Berücksichtigung der Erkrankung eine vertragsgerechte Beschäftigung erfolgen kann. Sieht der Arbeitsvertrag z.B. vor, dass dem Arbeitnehmer auch zeitlich begrenzt eine andere als die zuvor übertragene Tätigkeit zugewiesen werden kann, ist Arbeitsunfähigkeit zu verneinen, wenn eben eine solche andere Tätigkeit auch bei der vorliegenden Krankheit voll ausgefüllt werden kann!
Weiter muss die Krankheit alleinige Ursache für die Arbeitsverhinderung sein. Hätte der Arbeitnehmer schon aus anderen Gründen nicht gearbeitet, kann er keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall verlangen. Dies gilt z. B. für den Zeitraum eines unbezahlten Sonderurlaubs, was häufig verkannt wird. Weitere Beispiele sind Arbeitsausfälle bei Streik und Aussperrung sowie Kurzarbeit.
Schließlich ist erforderlich, dass die Arbeitsunfähigkeit ohne Verschulden des Arbeitnehmers eingetreten ist. Im Regelfall kann ein Verschulden des Arbeitnehmers verneint werden. Allerdings nimmt die Rechtsprechung ein Arbeitnehmerverschulden z. B. an, wenn der Arbeitnehmer Unfallverhütungsvorschriften bewusst missachtet hat und dadurch Schäden an der Gesundheit erleidete (LAG Hamm, Urteil vom 07.03.2007, Az.: 18 Sa 1839/06). Verschulden des Arbeitnehmers kommt auch bei der Missachtung des Verbots von Alkoholgenuss in Betracht. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Fragen der Verletzung von Arbeitnehmern beim Sport diskutiert worden. Zum Teil wird eine Unterscheidung zwischen gefährlichen und nicht gefährlichen Sportarten vorgenommen. Eine gefährliche Sportart soll dann anzunehmen sein, wenn das Verletzungsrisiko zu groß ist, dass auch ein gut ausgebildeter Sportler bei sorgfältiger Beachtung aller Regeln dieses Risiko nicht meiden kann. Es wird hier aber ein für den Arbeitnehmer großzügiger Maßstab angelegt. Das Bundesarbeitsgericht beurteilte z. B. das Drachenfliegen nicht als besonders gefährliche Sportart im Sinne der Lohnfortzahlungsbestimmungen, wenn die bekannten Sicherheitsvorkehrungen und Regeln beachtet werden (BAG, Urteil vom 07.10.1981, Az.: 5 AZR 338/79).
Auch Suchterkrankungen werden regelmäßig als unverschuldet betrachtet. Selbst bei Rückfall einer therapierten Suchterkrankung (Alkoholabhängigkeit, Nikotin, Drogen) soll es keinen Erfahrungssatz geben, der den Schluss auf ein Eigenverschulden des Arbeitnehmers rechtfertigt.
2. Inhalt des Entgeltfortzahlungsanspruchs
Der Arbeitnehmer behält unter den oben geschilderten Voraussetzungen den Anspruch auf Entgeltfortzahlung bis zur Dauer von 6 Wochen (42 Tage).
Die Höhe des fortzuzahlenden Entgelts bestimmt sich nach § 4 Entgeltfortzahlungsgesetz. Für den Entgeltfortzahlungszeitraum hat der Arbeitnehmer dass ihm bei der für ihn maßgebenden Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt fortzuzahlen. Es gilt das sogenannte Lohnausfallsprinzip: Der Arbeitnehmer hat die Vergütung zu beanspruchen, die er erhalten hätte, wäre er nicht erkrankt sondern zur Arbeit erschienen.
Bei Gehaltsempfängern ist der Entgeltfortzahlungsanspruch einfach zu ermitteln: Das regelmäßige Gehalt ist in ungekürzter Höhe weiter zu entrichten. Schwierigkeiten bestehen bei Provisionsempfängern sowie bei Leistungslohn/Akkordarbeit. Hier ist regelmäßig auf die Durchschnittswerte der Vergangenheit abzustellen.
Zu Einzelheiten beraten wir Sie gerne.
Kategorien und Themen
- Allgemein (5)
- Arbeitsrecht (164)
- Betriebsverfassungsrecht (38)
- Insolvenzrecht (1)
- Gebühren / Kosten (2)
- Gesellschaftsrecht (4)
- Sozialrecht (1)
- Rentenrecht (1)
- Zivilrecht (2)